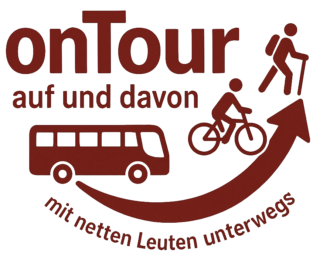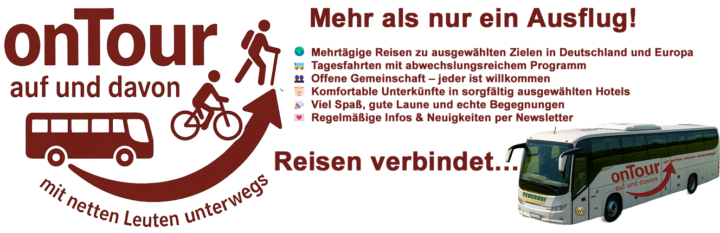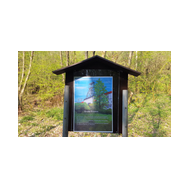Nördlicher Bergbaupfad

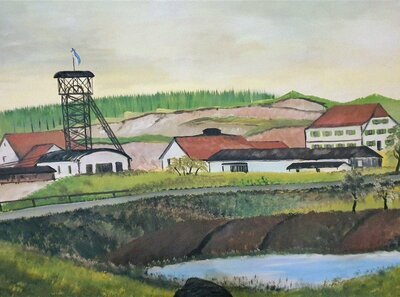 Auf den Spuren der Bergleute
Auf den Spuren der Bergleutemit Hacke, Helm und Humor
Eine Wanderung mit Tiefgang – zumindest geschichtlich
Wer glaubt, Wandern sei nur was für Naturromantiker mit Thermoskanne und Nordic-Walking-Stöcken, der war noch nicht mit uns auf dem nördlichen Bergbaupfad unterwegs! Hier wird Geschichte nicht trocken serviert, sondern mit einem Augenzwinkern und festem Schuhwerk erlebt.
Wir starten unsere Expedition ins „Ruhrgebiet des Mittelalters“ – ja, Sie haben richtig gelesen! Nicht Essen, nicht Dortmund, sondern Sulzbach-Rosenberg war im Mittelalter der Nabel der Eisenwelt. Da, wo heute Spaziergänger gemütlich durch die Landschaft schlendern, zogen früher schwitzende Bergleute mit Schaufel und Grubenlampe gen Grube. Und genau da wollten wir auch hin.
Unter der charmant-bergfesten Führung von Josef Rieder machten sich die Siedler vom Feuerhof auf zur Suche nach verborgenen Schätzen – oder zumindest nach Fundamenten, Fördertürmen und rostigen Erinnerungen. Ausgangspunkt war das Gasthaus „Zum Bartl“, wo sich schon viele Expeditionen formiert – und später regeneriert – haben.
Erste Station: Großenfalz. Dort ging es zur ehemaligen Grube Fromm, wo bereits im Mittelalter ordentlich gegraben wurde. Ob Fromm damals wirklich fromm war oder nur nach dem fünften Bier so genannt wurde, bleibt ungeklärt. Weiter ging’s in ein Gebiet, wo sich der Boden ordentlich abgesenkt hat – kein Wunder nach all dem Gebuddel. Heraus kam dabei ein stattlicher Weiher mit rund 10.000 m² Wasserfläche – also quasi ein Nebeneffekt des mittelalterlichen Tagebaus. Heute ein Paradies für Kröten, Vögel und Wanderer mit Kamera.
Und weil’s so schön war, haben die Großenfalz‘er einfach ihr ganzes Dorf verlegt – vorher noch schnell das Ablösegeld der Maxhütte eingesackt, dann Hütten abgerissen, Bäume stehen gelassen, fertig. Noch heute erzählen Obstbäume, Zaunreste und Mauerfragmente vom einstigen Dorfleben – und zwar ganz ohne Audioguide.
Auf dem Rückweg über Etzmansberg besuchten wir die Erzgrube Karoline mit dem legendären Förderschacht Klenze. Schon 1863 hat man dort in den Untergrund geschaut, wo heute nur noch Silos zwischen Bäumen hervorlinsen. Für romantische Gefühle blieb da kaum Zeit – der Magen knurrte, die Füße meldeten Muskelkater, und der Stammtisch im „Bartl“ wartete bereits.
Fazit: Der nördliche Bergbaupfad ist ein historischer Leckerbissen für Wanderfreunde mit Sinn für Geschichten, Humor und Gulaschsuppe. Und wer weiß – vielleicht findet man ja doch noch ein wenig Eisen … oder wenigstens eine rostige Erinnerung an eine Zeit, in der hier wirklich der Rubel rollte – äh, das Eisen floss.
Geführte Wanderung am Bergbaupfad
Wandern Sie mit den Wanderwarten Monika und Peter Preller auf den Spuren des Sulzbacher Bergbaus. Die Wanderung verbindet u.a. die Grubenfelder Großenfalz, die Bruchfelder am Annaberg und Galgenberg sowie den Eichelberg. Wanderzeit pro Route ca. 2,5-3 Stunden. Anmeldung: Familie Preller (Tel.: 09661 6200)
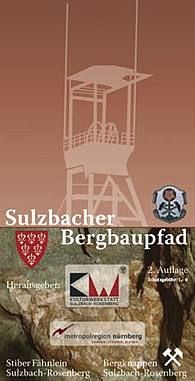
Der Sulzbacher Bergbaupfad bei der Oberpfälzer Stadt Sulzbach-Rosenberg ist eine der Stationen an der Bayrischen Eisenstraße. Die Oberpfalz war seit dem 13. Jahrhundert durch ihre Vorkommen an Eisenerz und Braunkohle eines der wichtigsten Eisenzentren Mitteleuropas und wird auch "Ruhrgebiet des Mittelalters" genannt.
Der Bergbaupfad zeigt ehemalige Tagesanlagen der Erzgruben, Arbeitswege der damaligen Bergleute und den Schaustollen "Max" der Feldbahn. Die Eisenerzvorkommen im Amberg-Sulzbach-Auerbacher Raum befinden sich an einer langen geologischen Störungslinie, die "Pfahl" genannt wird und sich vom Bayerwald bis nach Oberösterreich erstreckt.
Ausgangspunkt ist der Parkplatz unterhalb vom Annaberg.
Der Sulzbacher Bergbaupfad ist eine leichte Wanderung, auf der man allerhand Wissenswertes über den Eisenerzbergbau erfährt. Der Rundwanderweg besteht aus zwei Teilen, dem nördlichen und dem südlichen Bergbaupfad, die jeweils ca. 8 km lang sind. Die Route führt vorbei an Bruchfeldern, Erzgruben und Schächten. Die Grube St. Anna liegt ebenso am Weg wie der sanierte Schlackenberg mit seinem Dokumentationszentrum, die Maxhütte oder der Eichelberg mit dem nachweislich ältesten Bergbau in Sulzbach.
 Markierte Rundwanderwege Bergbaupfad Sulzbach-Rosenberg
Markierte Rundwanderwege Bergbaupfad Sulzbach-RosenbergNord (Naturschutzgebiet) ca. 8,0 km
und Süd ca. 8,0 km
Wanderbeschreibung: Nördlicher Bergbaupfad in Sulzbach-Rosenberg
Zur Wegbeschreibung können Sie auch die Broschüre „Bergbaupfad – Auf den Spuren der Bergleute“ benutzen. Hier sind alle Stationen eingezeichnet. Erhältlich bei der Touristinfo im Rathaus oder als Download.
Ausgangspunkt
Ihre Wanderung beginnt am Parkplatz beim Hotel-Gasthof „Zum Bartl“ in Sulzbach-Rosenberg. Nachdem Sie den Parkplatz verlassen haben, überqueren Sie die Edelsfelder Straße und folgen dem gut ausgeschilderten Feldweg. Der Weg führt Sie durch eine abwechslungsreiche Landschaft, geprägt von Wiesen, Feldern und bewaldeten Abschnitten, bis Sie den ersten wichtigen Aussichtspunkt erreichen.Aussichtspunkt
Von diesem Aussichtspunkt aus genießen Sie einen herrlichen Blick auf die schöne Oberpfälzer Landschaft. Nutzen Sie die Gelegenheit, um die weite Aussicht zu bewundern und die Ruhe der Natur auf sich wirken zu lassen. Der Aussichtspunkt bietet einen idealen Start, um die Umgebung kennenzulernen und sich auf die weiteren Stationen der Wanderung einzustimmen.Weiter zum Kalksteinbruch der Maxhütte (Punkt 8)
Der Weg führt weiter auf dem Kamm eines aufgeschobenen Rückens bis zu Punkt 8 auf der Karte: dem Kalksteinbruch der Maxhütte. Dieser historische Standort ist ein eindrucksvolles Zeugnis der regionalen Bergbaugeschichte. Der Kalksteinbruch bietet interessante Einblicke in die geologische Beschaffenheit der Region und die industrielle Nutzung der Landschaft.Abbiegen und Weg hinunter zu Punkt 7
An diesem Punkt biegen Sie links ab und folgen dem Weg hinunter zu Punkt 7 auf der Karte: dem Bruchgebiet der Grube Fromm. Hier begann bereits im Mittelalter der Bergbau im sogenannten oberen Lager. Das untere Lager wurde 1888 erstmals durch eine Bohrung erschlossen. Kurz darauf begann man mit dem Abteufen eines Schachtes, der nach vielen Unterbrechungen durch Schwimmsandeinbrüche 1895 bei 79 Metern das Erz erreichte.Bruchgebiet der Grube Fromm (Punkt 7)
Sie stehen nun vor dem Bruchgebiet der Grube Fromm. Während der Transport der Erze zur Hütte nach Rosenberg zunächst mit Pferdefuhrwerken erfolgte, wurde 1896 von hier über die Grube Etzmannsberg eine auf hölzernen Böcken verlegte Seilbahn bis zu den Hochöfen der Maxhütte gebaut. 1915 führte ein großer Schwimmsandeinbruch dazu, dass der Abbau vorübergehend stillgelegt wurde, und die Grube war bis zum Schacht mit Schwimmsand gefüllt. In den Dreißiger Jahren erfolgte der untertägige Zusammenschluss mit der Grube Karoline über die Grube Etzmannsberg. Trotz der Stilllegung im Jahr 1943 wurde der Abbau weitergeführt, und das Erz wurde auf die Grube Karoline gefördert. Auf der gegenüberliegenden Seite der Erzhülle, dem mit Wasser gefüllten Bruchgebiet, sind alte Fundamente der Grubenanlagen zu sehen. Auch im darüberliegenden Wald finden sich noch alte Gebäudefundamente.Station 6: Pulverkammer für den Schacht Großenfalz
An Station 6 befindet sich ein Hügel, auf dem einst die sogenannte Pulverkammer für das Abteufen des Schachtes Großenfalz stand. Hier wurde der Sprengstoff für die Grube streng gesichert aufbewahrt. Diese Kammer spielte eine entscheidende Rolle im Bergbauprozess, da der kontrollierte Einsatz von Sprengstoffen für den erfolgreichen Abbau unerlässlich war.Abbiegen ins alte Dorf von Großenfalz
Von der Pulverkammer aus biegen Sie nach rechts in das alte Dorf von Großenfalz ab. Dieses historische Dorf bietet einen faszinierenden Einblick in die Lebensweise der Bergleute und ihrer Familien.Station 5: Bruchgebiet des Feldes Großenfalz
Bei Station 5 haben Sie einen Blick auf das Bruchgebiet des Feldes Großenfalz. Durch den Abbau wurde die Erdoberfläche bis unter den Grundwasserspiegel abgesenkt, was zur Bildung eines etwa 10.000 Quadratmeter großen Weihers führte. Vor Beginn des Abbaus errichteten die Bewohner von Großenfalz mit dem Ablösungsgeld der Maxhütte und eigenen finanziellen Mitteln neue Höfe, die heute südwestlich verstreut liegen. Nachdem die Bewohner in ihre neuen Höfe umgezogen waren, wurde das alte Dorf abgerissen. Heute sind noch viele Grundmauern, Überreste von Gartenzäunen und zahlreiche Obstbäume zu sehen. Das Gebiet hat sich zu einem herrlichen Biotop entwickelt, in dem seltene Tiere eine unberührte Natur finden. Es wurde zum Naturschutzgebiet erklärt und ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie industrielle Eingriffe durch den Bergbau zu einer Bereicherung der Natur führen können.Rückweg zum Bauernhof und alte Rohrleitung
Vom Bruchgebiet des Feldes Großenfalz gehen Sie zurück bis zu einem Bauernhof auf der linken Seite und biegen vor diesem nach links ab. Unterwegs bemerken Sie am rechten Rand des Weges eine alte Rohrleitung, die einst zur Ableitung von Grubenwässern aus dem Feldesteil Großenfalz diente. Diese Wässer wurden zur Klärung in die Erzhülle der ehemaligen Grube Fromm gepumpt, auf die wir nun zugehen.Rückkehr in Richtung Etzmannsberg: Station 4
Jetzt gehen wir den Weg wieder zurück in Richtung Etzmannsberg. An Station 4 befand sich der Wetterschacht für den Feldesteil Großenfalz. Dieser wurde Anfang der Sechziger Jahre bis zu einer Tiefe von 110 Metern in liegendem Malmkalk geteuft. Das Feld Großenfalz war untertägig mit dem Annaschacht durch eine 3,8 Kilometer lange Strecke verbunden. Der Bergbau in diesem Bereich fand von 1962 bis 1975 statt. Der Schacht diente außerdem als Notforderung für die Belegschaft, die in diesem Feldesteil arbeitete. Mit der Stilllegung der Grube St. Anna im Jahr 1975 wurde der Wetterschacht verfüllt.Station 3: Wetterschacht der Grube Etzmannsberg
Weiter geht es zu Station 3, wo einst der Wetterschacht der Grube Etzmannsberg stand. Dieser Schacht wurde 1944/45 geteuft und in den Sechziger Jahren verfüllt. Die Grube Etzmannsberg spielte eine wichtige Rolle im regionalen Bergbau und ist heute ein interessantes Relikt der industriellen Vergangenheit.Station 2: Gelände der ehemaligen Erzgrube Etzmannsberg
Bei Station 2 befinden Sie sich auf dem Gelände der ehemaligen Erzgrube Etzmannsberg. Die Erzvorräte im unteren Lager wurden hier bereits 1856/57 durch den Josephsschacht und den Karlschacht erschlossen. Anfang 1860 wurde der Maxschacht geteuft, der nach mehrfachen Unterbrechungen durch Wassereinbrüche 1870 eine Tiefe von 102 Metern erreichte. In den Jahren 1871 und 1873 wurden zwei weitere Schächte an dieser Stelle bis zu ihren Endteufen getrieben. Heute können Sie hier alte gemauerte Fundamente des Schachtgerüstes, der Fördermaschine mit Ankerstangen und von Gebäuden sehen. Bereits 1916 hatte man die Grube bis zur 130-Meter-Sohle aufgeschlossen. 1922 wurde die Förderung aus diesem Feld auf die Grube Karoline verlegt, und der Schacht diente fortan als Wetterschacht. In den Fünfziger Jahren wurde er verfüllt. Wenn Sie nach Südwesten blicken, sehen Sie umfangreiche und tiefe Bruchgebiete der Grube Etzmannsberg. Die Absenkung der Erdoberfläche bis unter den Grundwasserspiegel führte zur Bildung von sogenannten Erzhüllen, in denen sich wertvolle Feuchtbiotope entwickelt haben. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass der Bergbau auch eine Bereicherung der Natur zur Folge haben kann.Station 1: Erzgrube Karoline mit Förderschacht Klenze
Wir folgen dem Weg nun zu Station 1, wo sich oberhalb die Erzgrube Karoline mit dem Förderschacht Klenze befand. Bereits 1863 wurde das Feld Karoline durch einen Schacht unweit des späteren Schachtes Klenze erschlossen. Nachdem der Klenzeschacht 1912 seine Endteufe von 125 Metern bis in den unterhalb des Erzes gelegenen Kalkstein erreichte und eine untertägige Streckenverbindung zum alten Schacht fertiggestellt wurde, wurde dieser alte Schacht stillgelegt und verfüllt. Von dieser Zeit bis zum Abbruch im Jahr 1962 war die Grube Karoline die Hauptfördergrube des Sulzbacher Bergbaus. Sie war nach Westen mit den ehemals selbständigen Gruben Etzmannsberg und Fromm untertägig verbunden. Zur Zeit der höchsten Förderung nach dem Zweiten Weltkrieg (1958) wurden hier täglich bis zu 2.000 Tonnen Erz gefördert, und bis zu 1.000 Bergleute fuhren täglich in die Grube ein. Mit der Fertigstellung des Annaschachtes unterhalb des Annaberges im Jahr 1958 und der untertägigen Verbindungsstrecke zum Schacht Klenze wurde die Grube Karoline geschlossen und der Schacht verfüllt.Rückweg zum Ausgangspunkt und Abschluss
Mit dem Abschluss der Stationen kehren Sie nun zum Ausgangspunkt zurück. Sobald Sie die B 14 und den Gasthof „Zum Bartl“ wieder erreichen, können Sie sich dort einer kräftigen Brotzeit erfreuen. In der großen Wirtsstube des Gasthofs ist als Wandgemälde eine weitere Darstellung der Grube Karoline zu sehen, die die Geschichte dieses bedeutenden Ortes eindrucksvoll illustriert.Quelle: Flyer Sulzbacher Bergbaupfad
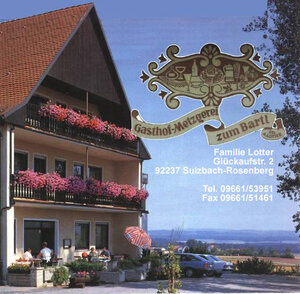
Hotel-Gasthof "Zum Bartl"
Glückaufstr. 2
92237 Sulzbach-Rosenberg
Tel: 09661 8 76 15-0
Fax: 09661 8 76 15 61
Mail: info@zum-bartl.de